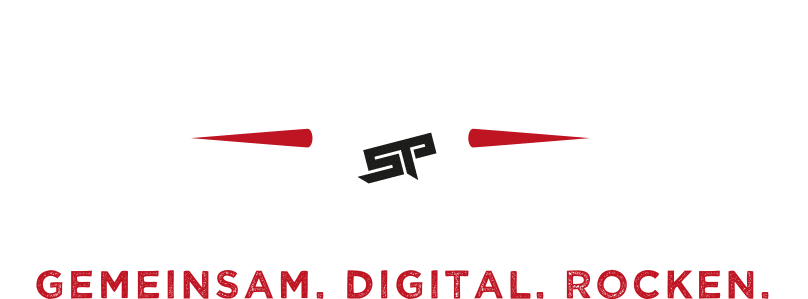Ich bin Frank Spiegelhoff.
Rockender Digitalisierer.
Eigentlich wollte ich Rockstar werden. Jetzt bin ich klarer und habe klare Ziele für softwareproduktiv.

Hey und willkommen auf der Teamseite von softwareproduktiv! Ich bin Frank, einer der beiden Geschäftsführer, und ich möchte euch mit auf eine Reise nehmen – meine Vision für unser Unternehmen.
Seit fast 20 Jahren rocken wir bei softwareproduktiv die Welt der kundenindividuellen Dienstleistungen für kleine und mittlere Unternehmen. Das ist kein Spaziergang im Park – unsere Arbeit ist komplex, und es braucht Jahre, bis neue Mitarbeiter ihr volles Potenzial entfalten. Aber genau hier setzt mein größter Traum an: Ich will ein Unternehmen, das vor Energie nur so strotzt! Eine Unternehmenskultur, in der unsere Mitarbeiter im Teamflow sind, ihre Potenziale entfalten, Menschlichkeit und Wertschätzung groß geschrieben werden und unsere Kunden vor Begeisterung strahlen.
Mit unserem alten Geschäftsmodell und meiner alten Persönlichkeit war das einfach nicht zu erreichen. Deshalb habe ich vor zehn Jahren angefangen, mich selbst weiterzuentwickeln. Und vor sechs Jahren haben wir dann richtig Gas gegeben: Wir haben neue Geschäftsmodelle entwickelt, ein dynamisches Startup namens SMARTCHILLI gegründet und arbeiten an einem revolutionären Produkt namens STLW speziell für die SHK-Handwerksbranche.
SMARTCHILLI hat bereits namhafte Kunden in der Veranstaltungsbranche überzeugt – sie nutzen es, um ihre Großveranstaltungen zu organisieren. Und mit STLW bieten wir SHK-Handwerksunternehmen eine Lagerverwaltung, die den Unterschied macht: Monteure verbringen ihre wertvolle Zeit auf der Baustelle und nicht im Lager, und ein Aufmaß ist überflüssig. Unsere ersten Pilotkunden sind hellauf begeistert!
Ich war meinem Traum noch nie so nah wie jetzt. Mit einem leidenschaftlichen Team, innovativen Produkten und einer Unternehmenskultur, die rockt, bin ich überzeugt, dass wir genau auf dem richtigen Weg sind. Ich freue mich darauf, diese aufregende Reise mit euch gemeinsam zu gehen.
Rockige Grüße,
Frank
Geschäftsführer softwareproduktiv